Le bellezze intraviste
Come se si facesse fatica riconoscere le innumerevoli bellezze con cui si presenta madre terra lasciando indifferenti alcuni altri a bocca aperta. Le varietà...
La tragedia della narrazione di Crans-Montana
A due settimane dalla tragedia di Capodanno di Crans-Montana siamo ancora sconvolti da quello che è accaduto. La tragedia ha...
Crans-Montana, l’ora del silenzio e del ricordo
È stata l’ora del silenzio. Dopo giorni carichi di dolore, polemiche, interrogativi e parole spesso affrettate, ieri a Martigny il...
Replica alle critiche ingiuste rivolte all’Ambasciatore d’Italia in Svizzera
Abbiamo letto con profondo rammarico le critiche rivolte all’Ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, in relazione alla tragedia avvenuta...
Genealogia dell’impunità (Israele come laboratorio del potere assoluto)
A Gaza, come a Kiev e in Cisgiordania, i bambini soffrono e muoiono tra macerie e fame, mentre l’occidente rivendica...
2026 con l’IA: chi c’è e chi non ci sarà più
Come ogni fine anno che si rispetti tiriamo le somme e facciamo un po’ il resoconto di quello che i...
Mario Biondi in concerto al Kaufleuten di Zurigo
Biglietti per il concerto di Mario Biondi a Zurigo: un ottimo regalo per Natale! Mario Biondi, nome d’arte del catanese...
Si pregano gli italiani all’estero di porgere l’altra guancia
Viviamo in un periodo in cui, se non si presta attenzione al flusso di informazioni provenienti dall’Italia, si rischia di...
I 50 anni del Palazzo dei Congressi e il recupero in 3D...
Due mostre uniscono storia ticinese e tecnologie digitali, dal libro sul Palazzo dei Congressi alla ricostruzione in “realtà aumentata” del...
F1 Grand Prix di Abu Dhabi: vince Verstappen, ma è Lando Norris...
Il pilota di McLaren conquista il titolo iridato 2025 con due punti di vantaggio su Verstappen; la Ferrari chiude una...
Quel legame che costa così caro agli italiani all’estero
Tra “caro voli” e “IMU light” meglio sperare nelle lotterie! Arrivati a questo punto o i giochi sono fatti o...
La logica immobiliare del genocidio (la rottamazione di un popolo)
Di fronte alla devastazione e alla sofferenza quotidiana a Gaza e in Cisgiordania, dove vite innocenti sono messe alla prova...
Onori (Azione): “Servizi sanitari per gli italiani all’estero, voteremo a favore ma...
“Abbiamo votato oggi un provvedimento importante che consente ai cittadini italiani all’estero iscritti all’AIRE di accedere ai servizi sanitari in...


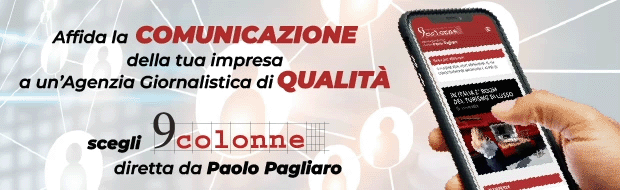


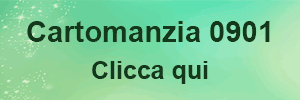

Commenti recenti